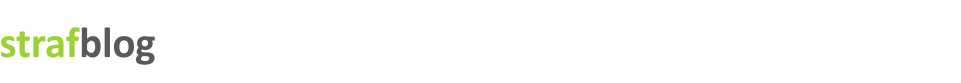Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht? Wenn man als Anwalt einen Freund vertritt, gehen Dinge schief, die sonst nie schiefgehen. Dinge verrutschen. Man trifft auf Zombies, die in der Gestalt eines Staatsanwalts oder Richters auftauchen, denen man sonst zum Glück nie begegnet. Und so bin ich froh, dass es auf den letzten Metern doch noch so gerade gut ausgegangen ist. Halt, was sage ich da? Wie kann man angesichts einer Tragödie von „gut“ sprechen!
Vielleicht lag es daran, dass mein Freund einen Professorentitel trägt und Seniorpartner einer großen internationalen Wirtschaftskanzlei ist. Das mag bei einem Amtsrichter Neid hervorrufen. Vielleicht hatte der Freund aber auch nur das Pech, dass für Straftaten von Anwälten eben besondere Staatsanwälte, zumeist Oberstaatsanwälte, zuständig sind, die sich auf die Verfolgung von Anwälten spezialisiert haben, nicht aber auf das spezielle Delikt, um das es geht. Vielleicht aber wollen weniger selbstbewusste Strafjuristen von vorneherein sich und der Welt beweisen, dass sie keine Krähen sind, sondern andere schräge Vögel, die einem, der das gleiche studiert hat, sehr wohl ein Auge aushacken können, – ja, der vermeintlichen Pflicht schuldend – müssen, und dabei jedes Augenmaß verlieren. Oder habe ich angesichts des Tragischen das meine verloren?
An einem sonnigen Wintertag im letzten Jahr erhielt ich den Anruf meines Freundes, dessen Stimme zitterte, als er mich nach meinem Wohlergehen fragte. Ich fragte zurück und erhielt die Antwort: „Ja, gut. Ich habe – glaube ich – gerade zwei Menschen getötet!“ Noch ehe ich die Bemerkung als einen seiner üblichen Scherze gegenüber einem Strafverteidiger einordnen konnte, fing er am Telefon an zu schluchzen und berichtete von dem schrecklichen Verkehrsunfall. Er sei noch im Krankenhaus. Er sei unverletzt. Er könne sich das nicht erklären. Er habe die Ampel einfach nicht gesehen. Plötzlich sei eine Person auf der Fahrbahn aufgetaucht. Er habe nach links ausweichen wollen und da sei plötzlich auch ein Mensch gewesen. Im Wissen, dass es nicht funktioniert, habe er sich instinktiv klein gemacht und versucht, das Auto zwischen den Personen hindurch zu lenken. Dann habe es geknallt und beide Personen seinen rechts und links am Wagen vorbeigeflogen.
Ich versprach, mich sofort um die Sache zu kümmern. Ich versuchte meinen schockierten Freund zu beruhigen, aber er war außer sich und konnte noch nicht zuhören. Gegen den eindringlichen Rat der Ärzte entließ er sich auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus. Seine Frau fuhr ihn 1-2 Stunden nach dem Unfall in das Hospital, in denen sich die Opfer befanden, und an der Rezeption traf er den Ehemann des einen Unfallopfers, der noch genauso wenig wusste, wie er. Mein Freund gab sich als der Schuldige aus und die beiden Männer tauschten weinend Telefonnummern aus. Über das andere Opfer war noch nichts zu erfahren.
Ich ließ alles stehen und liegen und hängte mich sofort ans Telefon. Der freundliche Polizeibeamte bestätigte den tragischen Verkehrsunfall. „Ja, es ist schrecklich! Der arme Professor tut mir so leid. Er war so verzweifelt und traumatisiert. Er lief wie ein aufgescheuchtes Huhn an der Unfallstelle herum und versuchte zu helfen. Aber da war nichts mehr zu helfen. Wir ließen ihn in ein Krankenhaus bringen. Nach einer ersten Auswertung der Zeugenaussagen vermuten wir, die von hinten einstrahlende, grelle Sonne hat ihm die Sicht auf die Ampel genommen. Die Opfer schweben in Lebensgefahr. Verdammt! So etwas kann jedem jederzeit im Straßenverkehr passieren! Ich melde mich, sobald ich etwas Neues erfahre.“ Ich bedankte mich für die nicht selbstverständliche Auskunft und faxte mein Bestellschreiben an das zuständige Dezernat.
Der Freund war nun zu Hause. Ich hörte ihm lange am Telefon zu. Wir trafen uns, um über seine Ohnmacht und darüber zu sprechen, wie man mit einer solchen Schuld leben könne. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Die juristischen Fragen aber besprach ich mit seiner Frau, die als erfahrene Richterin ihr Bestes gab, ihren Mann zu schützen und zu vermitteln. Der Selbstzweifel und die Selbstvorwürfe nisteten sich in den kommenden langen Monaten in dem einst hellen Haus der Familie ein. Sie krochen aus jedem Winkel hervor und überzogen die großen Fenster mit einem grauen Schleier. Als die verunfallte Fußgängerin starb und der ältere Herr noch weiter mit dem Tod rang, riss auch der letzte Hoffnungsfaden und die Gespräche am Tisch kreisten nur noch um tiefe Trauer und alles wurde einsilbig und schwer. In diesem Moment wurde alles für immer anders.
Nach drei Wochen erhielt ich die Ermittlungsakte. Ein Gutachter bestätigte die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges. Zeugen gaben an, sie seien mit 50 km/h längere Zeit hinter meinem Freund hergefahren. Sie selbst hätten die Ampel nicht gesehen. Die Sonne habe die Ampelanlage bestrahlt. Zwei Zeugen berichteten, dass an der Unfallstelle etwas mit der Ampelschaltung nicht stimme. Immer wieder hätten sie beobachtet, dass Fahrzeuge bei Rot über den Zebrastreifen führen. Die Ampelschaltung sei eindeutig zu kurz bemessen.
Für alle Fälle heftete ich das Obduktionsgutachten aus und schickte eine Kopie der Akte an die Frau meines Freundes. Ich nahm Kontakt zu Unfallzeugen und der Betreuerin des immer noch im Koma liegenden älteren Herren auf. Von allen hörte ich immer das Gleiche. „Bitte richten sie dem Professor unser aufrichtiges Mitleid aus. Das hätte jedem passieren können.“ Mein Freund hatte derweil Kontakt zu dem Ehemann und den erwachsenen Kindern der Verstorbenen aufgenommen und berichtete von stundenlangen, tränenreichen Gesprächen, in denen ihm verziehen worden sei. Die Angehörigen hätten gesagt: Jedem könne so etwas passieren. Er solle nicht auch noch seine Familie mit seinen Selbstvorwürfen zerstören. Mein Freund fragte sich, ob er ebenso großherzig hätte sein können. Er war dankbar für den Zuspruch, aber seine Gefühlslage änderte sich kaum. Er ließ sich von Kardiologen, Neurologen, Psychiatern und anderen Ärzten untersuchen, die keine gesundheitliche Erklärung für seine Unaufmerksamkeit fanden. Der eingeschaltete Psychotherapeut riet ihm sich schnell wieder ans Steuer zu setzten und die Arbeit am Lehrstuhl und der Kanzlei wieder aufzunehmen. Nur so könne er die Angst überwinden und dauerhaften Schaden von sich abwenden. Erst nach zwei Monaten folgte er sporadisch und stundenweise diesem Ratschlag. Ein wirkliches Arbeiten aber war nicht möglich. Immer wieder tauchte die Unfallszene in seinem Kopf auf und blockierte sein Leben.
Ich nahm Kontakt zur Oberstaatsanwältin auf und verhandelte mit ihr über die Erledigung des Verfahrens im Strafbefehlswege. Sie schlug 1 Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung vor, was ich rundweg ablehnte. Irgendwann sah sie ein, dass bei meinem Freund ein Augenblicksversagen vorgelegen hatte, das den leichtesten Grad von Fahrlässigkeit begründete, und sie räumte breitwillig ein, dass das jedem jederzeit im Straßenverkehr genauso passieren könnte. In weiteren Telefonaten betonte sie immer wieder die schweren Folgen, ging aber in ihren Vorstellungen auf 9 Monate und dann auf 6 Monate runter. Auch hiermit war ich nicht einverstanden. Wir verabredeten uns zu einem persönlichen Gespräch. Sie sollte meinen Mandanten kennenlernen. Sie empfing uns freundlich in ihrem Dienstzimmer und mein Freund redete sich – einem tiefen Bedürfnis folgend – die Qualen der letzten Wochen von der Seele. Die Oberstaatsanwältin schien nun deutlich verunsichert und versprach über eine Geldstrafe nachzudenken. Sie wolle mit einem Fachdezernenten darüber reden, und ich könne ja noch schriftlich vortragen.
In einem langen Schriftsatz analysierte ich dutzende von vergleichbaren Entscheidungen und Verurteilungsstatistiken der letzten Jahre, die eindeutig belegten, dass die Rechtsprechung – selbst in Bayern – bei dem vorliegenden Grad der Fahrlässigkeit (ohne Geschwindigkeitsüberschreitung oder Alkohol am Steuer) zu eher milden Geldstrafen tendiert und regelmäßig auch von einem Fahrverbot absieht, da die damit verbundene spezialpräventive „Denkzettelfunktion“ als überflüssig angesehen wird.
Kurz darauf erhielten wir einen Strafbefehl mit 180 Tagessätzen und 3 Monaten Fahrverbot. Zwischenzeitlich hatte der Professor telefonische Mitleidsbekundungen von verschiedenen OLG-Richtern und einem Generalbundesanwalt bekommen, die mich in der Meinung unterstützen, er solle nicht in Sack und Asche gehen, sondern kämpfen. Obwohl ihm – ganz entgegen seiner Natur – nicht nach Kampf war und er den juristischen Teil der Angelegenheit einfach nur hinter sich bringen wollte, stimme er schließlich der Einspruchseinlegung zu.
Drei Wochen vor der Hauptverhandlung rief ich den zuständigen Amtsrichter an und erläuterte ihm das Ziel des Einspruchs. Der Richter wirkte vernünftig und wieder hörte ich den Satz: „Ja, das ist schrecklich und könnte mir heute auf dem Nachhauseweg genauso passieren. Einen Moment in Gedanken und schon kann es mit unabsehbaren Folgen knallen. Und Sie haben Recht: Wenn schon der Therapeut dringend dazu rät, das Autofahren wieder aufzunehmen, wozu dann noch ein Fahrverbot?! Ich könnte mir denken, dass ich vielleicht auf einen Monat runtergehen könnte. Ob wir angesichts der schweren Folgen aber auf 90 Tagessätze kommen, kann ich Ihnen nicht versprechen.“ Ich wies den Richter auf die Inkonsequenz seiner Argumentation hin und bat ihn, sich erst einmal einen Eindruck vom Angeklagten zu machen.
Einige Tage später erhielt ich die Mitteilung des Gerichts, ein unfallrekonstruierendes Sachverständigengutachten sei in Auftrag gegeben worden und sämtliche Zeugen seien geladen. Wieder hängte ich mich an´s Telefon und fragte den Richter, ob er unser letztes Telefonat vergessen hätte. Das Übersehen der Ampel sei doch bereits eingeräumt und es gehe nur noch um die Strafe und das Fahrverbot. Irgendetwas hatte den Vorsitzenden in der Zwischenzeit gedreht. Mehr oder weniger deutete er nun an, dass mein Mandant doch mit dem Strafbefehl bestens bedient sei und er nicht mehr ausschließen wolle, dass sein Urteil auch deutlich höher ausfallen könne als der Strafbefehl. Der Herr Professor solle sich vielleicht überlegen, den Einspruch zurückzunehmen. `Na, das kann ja noch heiter werden!`, dachte ich einigermaßen pikiert.
Die Hauptverhandlung begann. In einem langen „opening-statement“ drückte ich nochmals das tiefe Bedauern meines sichtlich neben mir zusammengesunkenen Mandanten aus, erläuterte sein „Nachtatverhalten“ und warum er nur schlecht mit einer im Bundeszentralregister einzutragenden Strafe und dem 3-monatigen Fahrverbot leben könne. Ich zitierte die vorliegenden ärztlichen Atteste und wies auf das einmalige Augenblicksversagen und die hinzukommenden ungünstigen Umstände hin. Ich verwies auf die Verurteilungstatistiken und darauf, dass die schweren Folgen des Unfalls nichts an dem leichten Fahrlässigkeitsgrad änderten. Mit anderen Worten, ich redete mir den Mund fusselig. Der Richter zeigte demonstratives Desinteresse. Als ich geendet hatte, fragte er stattdessen, ob wir ernsthaft glaubten, er werde von der im Strafbefehl festgestellten Tagessatzhöhe ausgehen. Er habe sich über die berufliche Position des Professors erkundigt und werde ihn mit soundsoviel Jahreseinkommen schätzen. Da platzte mir der Geduldfaden und ich sprach nun meinerseits deutliche Worte zu den hanebüchenen Vorstellungen des Richters, die ihn für einen Moment zurückzucken ließen. Den fälligen Befangenheitsantrag unterdrückte ich schweren Herzens, weil ich wusste, dass mein Mandant keinen weiteren Prozesstag durchstehen konnte und wollte. Versteckt sarkastisch befragte der Richter nun die Zeugen, die alles, was wir bisher vorgetragen hatten, bestätigten. Mehrfach musste ich seine Fragen und Zusammenfassungen rügen, da er offensichtlich die Aussagen möglichst negativ verstehen wollte. Wenn ein Zeuge z.B. sagte, er habe vor der Ampel gebremst, wahrscheinlich infolge der gerade stattgefundenen Kollision, verstand der Richter, der Zeuge habe also im Gegensatz zum Angeklagten die Ampel eindeutig gesehen und daher gebremst. Die aufgekommene Spannung versuchte der Vorsitzende dann wegzuwitzeln. Als er sich z.B. zweimal hintereinander bei dem Alter eines Zeugen, einem Rechtsanwalt, verrechnet hatte, erlaubte er sich die Bemerkung, dass es lobenswert sei, dass der Herr Anwalt seinen Fehler überhaupt bemerkt habe. Eine weitere Zeugin, ebenfalls Rechtsanwältin, bekundete, dass der Angeklagte nach dem Unfall völlig verstört umhergelaufen sei und mit den Worten – „vielleicht habe ich an die Gesellschaftsversammlung gedacht.“ – nach einer Erklärung für seine Unaufmerksamkeit gesucht habe, die er dann im nächsten Satz mit der Bemerkung verworfen hätte, „Nein, ich habe die Ampel einfach nicht gesehen!“ Als der Richter daraus konstruieren wollte, der Angeklagte habe also Stress wegen der Gesellschafterversammlung zum Ausdruck gebracht, korrigierte ihn die Zeugin scharf. Nein, so habe sie das nicht gesagt und gemeint. Der Angeklagte habe offensichtlich eine Erklärung für seine Unaufmerksamkeit gesucht, aber wohl nicht gefunden. Den einzigen Zeugen, dem der Richter zuhörte, war ein – wie später vom Sachverständigen nachgewiesen – verpeilter Wichtigtuer, der als einziger Zeuge, einen waghalsigen Spurwechsel meines Mandanten unmittelbar vor dem Unfall gesehen haben wollte. Die im Zuschauerraum noch anwesenden bereits gehörten Zeugen und eine mit meinem Mandanten befreundete OLG-Richterin schüttelten mittlerweile nur noch demonstrativ den Kopf über die Verhandlungsführung des voreingenommensten Richters, den ich – glaube ich – jemals erlebt habe. Nach Abspulen des Beweisprogramms hatte es der Richter plötzlich eilig, die Beweisaufnahme zu schließen, was ich durch die Anmerkung, ich müsse noch über Beweisanträge nachdenken, zu seiner sichtlichen Verärgerung verhindern konnte. Stattdessen schlug ich ein Rechtsgespräch vor, das der Richter dann auch sofort dazu nutzte, noch einmal mit der Verböserung des Strafbefehls zu drohen. Unwirsch fiel ich ihm mit der Bemerkung ins Wort, dass ich seine Meinung kenne. Mich würde vielmehr die Meinung der Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft, die das ganze Possenspiel bisher nicht kommentiert hatte, interessieren. Die Staatsanwältin schaute auf, räusperte sich und sprach sich mit meiner Argumentation gegen ein Fahrverbot und für eine Reduzierung der Geldstrafe aus. Verblüfft schaute sie der Richter an und ruderte sofort zurück. Nach Rücksprache mit meinem mittlerweile völlig verstörten Mandanten einigten wir uns auf den Vorschlag der Staatsanwältin. Für mehr hatte mein Mandant keine Kraft mehr. Der Vorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und verkündete das abgesprochene Urteil. Ohne rot zu werden, führte er aus, dass ein Fahrverbot ja schon medizinisch kontraindiziert wäre und der Unfall – leider, leider – jedem so hätte passieren können. Beim Hinausgehen fragte er mich, was ich denn für einen Stundensatz hätte, falls er mich mal als Strafverteidiger bräuchte. Ich erwiderte, ich sei teurer als der Professor. Dem Vorsitzenden würde ich allerdings einen Freundschaftspreis anbieten. Darauf lachte er und sagte: „Ich habe doch nur einen Scherz gemacht!“ Ich erwiderte ohne die Spur eines Lächelns: „Ich auch!“
Rechtsanwalt Gerd Meister, Mönchengladbach
Kategorie: Stories
Permalink: Bretter, Bretter, Bretter. Nein, wie schrecklich. Das hätte doch jedem von uns passieren können.
Schlagworte: Gerd Meister, Mönchengladbach, Oberstaatsanwältin, Professor, Rechtsanwalt, Richter, Stundensatz, Verkehrsunfall
vor:
 Das Meer der Möglichkeiten
Das Meer der Möglichkeiten zurück:
 George Orwell´s Baseballkappe
George Orwell´s Baseballkappe