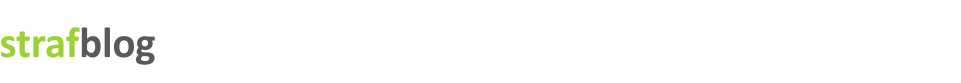Für alles braucht man heute einen Schein: Führerschein, Segelschein, Angelschein, Schweißschein, Surfschein … Selbst Heilige und andere Gute – sie brauchen einen Schein!
Der Prozess, den ich zurzeit vor einer Schwurgerichtskammer verhandele, verschlägt allerdings selbst hartgesottenen Strafrechtlern den Satiregeist.
Heute, nach dem zweiten Verhandlungstag, in dem behandelnde Ärzte und der Gerichtsmediziner gehört wurden, verließ ich mit meinem Jurapraktikanten Christoph den Gerichtssaal. Mit einer Zigarette verabschiedeten wir uns in meinem Büro ins Wochenende. Ich hatte das Gefühl, dass Christoph genauso nachdenklich und betroffen war wie ich. Wir überlegten, ob es nicht einen Führerschein für werdende Eltern geben müsste. Vielleicht keinen Schein mit Prüfung, aber wenigstens eine umfangreiche Einweisung darin, wie man mit einem kostbaren, neuen Leben umzugehen hat, worin die Gefahren für das Kind und einen selbst liegen und was auf gar keinen Fall passieren darf.
„Passieren“? So, als ob das Schicksal wie eine Flut über einen hineinbricht?
„Es ist ein Unfall passiert! Ein Ungeschick!“ Mit einem Surfboard auf einer wunderschönen, gigantischen Lebenswelle gleitend. Ich bin stolzer Vater. Zu hoch. In einem überlappenden Tunnel aus kristallklarem, rauschendem Wasser und plötzlich – bei rasanter Fahrt – die verzweifelte Erkenntnis: Ich kann gar nicht surfen. Eine erschrockene, unbeherrschte Gewichtsverlagerung, und das Schicksalsbrett kippt und reißt alles in einem vernichtenden Strudel mit sich in die Tiefe. Benommen schaut er sich um. Und neben ihm liegt sein kleiner Sohn, und daneben liegt die Frau, die er liebt – die nie verzeihende Mutter – auf dem harten, sandigen Meeresboden.
So ist es nicht! Bei weitem nicht! Und vielleicht doch?
Der Angeklagte, ein junger, mir sympathischer Mann. Ein gebrochener junger Mann, der mit 24 Jahren alle gesellschaftliche Sympathie verspielt hat. Für den in der Untersuchungshaft „Einzelduschen“ angeordnet ist. Der in eine andere Haftanstalt verlegt wurde, weil er ansonsten von den Mitgefangenen als Kinderschänder verprügelt worden wäre. Der aus gleichem Grunde seinen einstündigen Hofgang alleine macht. Er umkreist den Gefangenenhof. Schritt für Schritt im Kreise, eine Stunde lang, bis er für die restlichen 23 Stunden in seine karge Einzelzelle geführt wird. Er atmet die kalte Luft, aber er spürt sie nicht. Er denkt an seinen jetzt 8-monatigen Sohn und hofft. Er hofft, dass sein Sohn es schafft, dass er überlebt, dass alles irgendwie gut wird, und er weiß, dass nichts mehr gut wird. Aber, ist es nicht ein gutes Zeichen, dass der Kleine nicht mehr krampft? Dass er anscheinend doch hören und vielleicht wird sehen können? Dass er irgendwann wird gehen und reden können? Sein Sohn, auf den er so stolz war. Er hat versagt, und was kann er jetzt noch tun – für seinen Sohn, für die Mutter? Was? Er denkt wieder daran, sich das Leben zu nehmen. Schon zweimal hat er es in der Haft probiert. Er schafft es nicht. Alles würde er dafür tun, es rückgängig zu machen. Alles. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen.
Er lernte Maria während seines Zivildienstes kennen. Sie absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr, und gemeinsam besuchten sie einen Kurs für Zivis, lernten sich kennen, liebten sich, und eines Tages war Maria schwanger. Beide waren verunsichert, und sie freuten sich. Sie zogen zusammen. Zunächst in eine miese Bruchbude in einer miesen Gegend. Schon bald fand er einen Job als Lagerarbeiter. Dem Kleinen zu Liebe zogen sie in eine bessere Wohnung. Sie waren glücklich, obwohl das Geld vorne und hinten nicht reichte. Aber bei wem reicht es schon in so jungen Jahren, wenn man eine Familie gründet? Sie waren überzeugt, es zu schaffen. Maria widmete sich liebevoll dem Säugling. Er gab sich alle Mühe, es ihr gleich zu tun, aber manchmal fühlte er sich überfordert. Er fand nicht den gleichen Zugang zu dem Kleinen wie Maria. Oft war er nach der langen Arbeit müde. Vielleicht fühlte er sich zuweilen auch zurückgesetzt. Er liebte den Kleinen, und eines Tages würde der Kleine auch ihn lieben. Maria fand einen Wochenendjob. Für einige Stunden wollte sie etwas dazuverdienen und mal rauskommen aus diesem anstrengenden Mutterdasein. Er blieb mit dem Kleinen zu Hause und Maria glaubte, es sei gut für die Beiden. Sie sollten lernen wenigstens ein paar Stunden alleine zurechtzukommen. Jede Stunde rief sie ihn an oder schrieb eine Whatsapp und erkundigte sich, wie es den beiden ging. Manchmal klappte es tadellos, aber oft bekam sie zu hören, dass der Kleine sich nicht beruhigen lasse. Er habe alles versucht. Ob er schon wieder Hunger habe? Ob es an den Blähungen liegen könnte? Warum schrie der Kleine fortwährend? Warum bekam er das nicht so hin wie die Mutter? Er hatte ihn auf den Arm genommen, war mit ihm Spazieren gefahren, hatte ihn gewiegt und gewickelt. Hatte Faxen gemacht, um den Kleinen abzulenken. Nichts hatte funktioniert. Der Säugling schrie und schrie. War es eine aus Verzweiflung geborene Wut, die ihn eines Tages dazu brachte, den Kleinen zu schütteln?
Danach war der Kleine endlich eingeschlafen. Hatte er schon da ein schlechtes Gewissen oder nur das Gefühl ein Versager zu sein?
Kann man verstehen, dass einem Elternteil die Sicherung durchbrennt, dass einem die Hand ausrutscht, dass ein Damm bricht und einen die Wut wegspült? Und was für Kräfte müssen gegen diesen Damm gedrückt haben, oder wie dünn müssen dessen Wände gewesen sein, dass so etwas „passiert“? Und dass es danach an verschiedenen Wochenenden noch mindestens fünfmal passierte, bis – beim letzten Male – der Kleine die Augen verdrehte und er endlich merkte, dass man die Zeit tatsächlich nicht zurückdrehen kann. Kann man das verstehen?
Der Kleine lag in seinen Armen wie ein halbvoll mit Wasser gefüllter Beutel. Er atmete nicht mehr, dann ein einzelnes Röcheln, eine Stoßatmung, dann nichts mehr. Panik überfiel den Vater. Tränen rannen ihm aus den Augen. Er sah wie sich das kleine Gesichtchen weiß und die kleinen Lippen blau färbten. Mit dem leblosen Bündel im Arm rannte er zur Nachbarswohnung, klingelte Sturm, und zum Glück waren die Nachbarn da. Sie nahmen ihm das Kind ab, unternahmen laienhafte Reanimationsmaßnahmen und alarmierten den Rettungswagen, der in wenigen Minuten vor Ort war. Sie brachten den Kleinen lebend in die Klinik, wo sich die Ärzte sofort daran machten, den Säugling zu stabilisieren. Ein Arzt fragte ihn, was passiert sei. Ob er das Kind geschüttelt habe, und unter Schluchzen räumte er seine Tat ein.
In der Hauptverhandlung hören wir den Gerichtsmediziner, der von schwersten Hirnschäden berichtete, von Scherwirkungen die beim Schütteln eines Kleinkindes am Übergang vom Rückenmark zum Stammhirn entstehen. Wie Sehnerven irreparabel reißen können, wie alle lebensnotwendigen Gehirnzentren für immer zerstört werden können, und dass bei dem kleinen Opfer noch nicht gesagt werden könne, ob er nur in seiner Reife erheblich verzögert sei, oder ob er für immer schwerstbehindert ans Bett gefesselt bleibe. Erst die Zeit werde es zeigen.
Der behandelnde Kinderarzt hatte vorab dem Gericht einen ärztlichen Bericht zugesandt, in dem er den Zustand des Kindes so zynisch erklärt, dass einem die Luft wegbleibt. Das Kind sei allenfalls noch ein „lebendiger Organspender“. In der Hauptverhandlung gibt er sich ähnlich empathielos und beschreibt, was die als Nebenklägerin anwesende Mutter zu erwarten habe. Noch sei das Kind klein und niedlich. Die Mutter wisse aber nicht, was sie zu erwarten habe. Mit 30 werde sie den dann erwachsenen Sohn mit einem Badekran in die Wanne heben müssen. Das Kind werde niemals Fortschritte machen. Es werde lediglich auf dem Rücken liegen können – ohne bewussten Blickkontakt zur Umwelt, ohne jemals irgendetwas zu können.
Was hilft es, dass ich den Kinderarzt schon ob seiner Sprachwahl und Gefühlslosigkeit für ein Arschloch halte und darin von einem im Publikum anwesenden Arzt bestätigt werde? Was nützt es, wenn andere behandelnde Ärzte die Auffassung des Gerichtsmediziners bestätigen, dass man zur weiteren Entwicklung noch nichts sagen könne. Dass man abwarten und hoffen müsse und es doch erste hoffnungsvolle Anzeichen gäbe, dass das Kind doch hören und sehen könne. Dass es die Mutter erkenne und dabei viel lächele, die Prognose aber für schlimmste, dauerhafte Behinderungen spräche.
In einer kurzen Sitzungspause ziehe ich mich mit dem Angeklagten zurück in das schäbige Treppenhaus, das hinunterführt in den im Keller gelegenen Zellentrakt. Ich setzte mich auf die Stufen. Der Angeklagte, der Vater, steht zitternd und schluchzend vor mir. Ich drehe ihm eine Zigarette, zünde sie an und reiche sie ihm. Vielmehr Tröstendes fällt mir nicht ein. Mir liegt der Satz auf der Zunge, dass das Leben weitergeht, er auf der Talsohle angekommen sei und den Mut nicht aufgeben solle. Aber die Worte kommen nicht über meine Lippen. Ich nehme ihn in den Arm und sage doch so etwas Bescheuertes wie – „Das wird schon.“ – und „Mach jetzt keine Dummheiten! Versprichst du mir das?“
Danach sitze ich mit Christoph in meinem Büro. Wir haben beide einen Kloß im Hals und reden über einen Führerschein für werdende Eltern. Wir sind uns einig, dass wir nicht noch mehr staatliche Reglementierung und Einmischung brauchen, dass es jetzt schon genug ist, dass die Freiheit auf dem Spiel steht – aber … Verdammt!!! Wäre dieses tragische Ereignis vermeidbar gewesen? Jeder weiß, dass man einen Säugling wie ein Wattepflänzchen behandeln muss, dass man ihn nicht schütteln darf! Jeder weiß, dass zu schnelles Autofahren zu katastrophalen Folgen führen kann – auch die zumeist männlichen Fahranfänger. Und doch, passieren bei ihnen die meisten tödlichen Verkehrsunfälle. Es gibt Pilotprojekte, bei denen Fahranfängern mit schockierenden, realistischen Bildern veranschaulicht wird, welche Folgen verantwortungsloses Fahren hat. Nach meinen Informationen mit großem Erfolg. Hätte es genutzt, wenn die Hebamme, der Kinderarzt, ein Kurs für werdende Eltern dem Angeklagten seine Verantwortung in den Schädel gehämmert hätte? Wenn man ihm immer wieder vor Augen geführt hätte, dass Eltern an ihre Grenzen stoßen können? Dass das nichts Schlimmes ist. Dass man sich Hilfe holen kann. Dass man kein Versager ist, wenn einem die Dinge zuweilen über den Kopf wachsen. Wären die mahnenden Worte kurz vor dem Dammbruch – jenseits des theoretischen Wissens – in sein Bewusstsein gesickert? Wäre im letzten Moment eine rote Lampe angegangen? Hätte es „klick“ gemacht?
Rechtsanwalt Gerd Meister, Mönchengladbach
Kategorie: Stories
Permalink: Du darfst (d)ein Kind nicht schütteln!
Schlagworte: Gerd Meister, Kind, Kurs für werdende Eltern, Mönchengladbach, Rechtsanwalt, Schütteln, schwerstbehindert, Vater
vor:
 Wir sind auf der Seite der Bösen!
Wir sind auf der Seite der Bösen! zurück:
 Ich – das Tagebuch eines Gestörten
Ich – das Tagebuch eines Gestörten