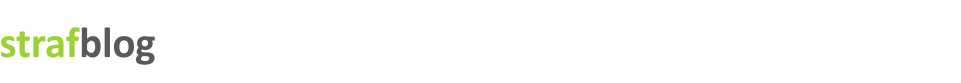Es ist eine Binsenweisheit, dass Zeugen das schlechteste Beweismittel überhaupt sind, weil sie lügen, irren, verwechseln und durcheinanderbringen können, weil sie fremd- und autosuggestiven Einflüssen unterliegen können und weil man ihnen halt nur vor den Kopf und nicht in den Kopf hineinschauen kann. Richter haben es bisweilen nicht leicht mit ihnen, weil sie die Aufgabe und Verpflichtung haben, im Rahmen ihrer freien Überzeugungsbildung herauszufinden, was man dem Zeugen denn nun glauben kann oder auch nicht. Bisweilen erscheint uns Verteidigern das Ergebnis richterlicher Überzeugungsbildung als Kaffeesatzleserei, weil wir – das mag funktional bedingt sein – zu einer völlig anderen Sichtweise gekommen sind, nachdem wir die die Zeugenvernehmung mit unseren sonstigen Erkenntnissen abgeglichen und insgesamt Revue passieren gelassen haben.
Es ist eine Binsenweisheit, dass Zeugen das schlechteste Beweismittel überhaupt sind, weil sie lügen, irren, verwechseln und durcheinanderbringen können, weil sie fremd- und autosuggestiven Einflüssen unterliegen können und weil man ihnen halt nur vor den Kopf und nicht in den Kopf hineinschauen kann. Richter haben es bisweilen nicht leicht mit ihnen, weil sie die Aufgabe und Verpflichtung haben, im Rahmen ihrer freien Überzeugungsbildung herauszufinden, was man dem Zeugen denn nun glauben kann oder auch nicht. Bisweilen erscheint uns Verteidigern das Ergebnis richterlicher Überzeugungsbildung als Kaffeesatzleserei, weil wir – das mag funktional bedingt sein – zu einer völlig anderen Sichtweise gekommen sind, nachdem wir die die Zeugenvernehmung mit unseren sonstigen Erkenntnissen abgeglichen und insgesamt Revue passieren gelassen haben.
Zur „sicheren Überzeugung“ des Gerichts habe der Zeuge wahrheitsgemäß ausgesagt, wird uns dann in der Urteilbegründung mitgeteilt, und wir fragen uns, wie bei so viel Konfusion und Widersprüchen eine sichere Überzeugung entstehen konnte.
Manchmal werden Glaubhaftigkeitsgutachten über Zeugen erstellt, weil die ureigene Sachkunde des Gerichts vermeintlich nicht ausreicht, die Glaubwürdigkeit des Zeugen beziehungsweise die Glaubhaftigkeit seiner Angaben zu beurteilen, und dann erzählen uns Psychologen etwas über die innere Schlüssigkeit und Erlebnisbezogenheit von Aussagen, über Aussagekonstanz und denkbare Falschbelastungsmotive, über Suggestionen und über vorhandene oder fehlende Fähigkeiten zur Fabulation. Besonders häufig geschieht das in Missbrauchsverfahren, weil kindliche Zeugen durch ein Gericht angeblich weniger gut beurteilt werden können als Erwachsene, oder dann, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, das psychische Grunderkrankungen bei einem Zeugen vorliegen, Psychosen, Borderline-Erkrankungen, depressive Episoden oder ähnliches. Der Bundesgerichtshof hat Kriterien für solche Gutachten erarbeitet, die heute nahezu schematisch von allen Gutachtern angewandt werden, wobei ich mir dennoch nicht sicher bin, ob das immer zu zutreffenden Ergebnissen führt. Aus Verteidigersicht kommt dabei der sogenannten „Null-Hypothesen-Theorie“ (auch „Unwahr-Hypothesen-Theorie“ genannt) eine besondere Bedeutung zu, weil bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen arbeitstechnisch davon ausgegangen werden soll, dass die zu begutachtende Aussage unwahr ist. Nur dann, wenn sich bei Abarbeitung sämtlicher Glaubhaftigkeitskriterien ergibt, dass die Unwahr-Hypothese nicht haltbar ist, darf der Gutachter bzw. die Gutachterin und ihm oder ihr folgend das Gericht die belastende Aussage für wahr halten. Das klingt gut, ist aber im Einzelfall auch eine recht willkürliche Angelegenheit. Es ist mir schon mehr als einmal gelungen, scheinbar überzeugende Glaubhaftigkeitsgutachten mit methodenkritischen Gegengutachten aus den Angeln zu heben.
Gestern haben wir in dem beim Landgericht Köln anhängigen Schwurgerichtsverfahren, in dem es um einen 61-jährigen Mann geht, der mutmaßlich aufgrund einer Personenverwechslung halbtot geschlagen worden sein soll, einen 69-jährigen Tatzeugen erlebt, der mit seinen Ausagen vermutlich alle Prozessbeteiligten überrascht hat. Der Mann war unmittelbar nach der Tat von Polizisten angehört und später noch einmal ausführlich vernommen worden. Mit keinem Wort hatte der Mann damals bekundet, dass er das Tatgeschehen selbst gesehen habe. Er habe eine Frau um Hilfe rufen gehört und sei zunächst davon ausgegangen, diese sei selbst Opfer eines Überfalls geworden. Er habe dann vier Männer aus einer Straße kommen sehen, die er dann für ein, zwei Minuten aus den Augen verloren habe. Später sei dann aus der Richtung, in der die Männer verschwunden waren, ein Pkw mit vier Personen gekommen, dessen Kennzeichen er sich gemerkt habe. Das seien dieselben Personen gewesen, die zuvor aus der Straße gekommen waren. Er habe dann von einem Kiosk aus mit dem Telefon des Kioskbesitzers die Polizei angerufen und das Kennzeichen mitgeteilt.
Gestern meinte der Zeuge, er habe das Tatgeschehen selbst „schemenhaft“ gesehen. Mindestens zwei Personen seien in einen Tumult verwickelt gewesen. Er habe gesehen, wie ein Mann eine Stange mit beiden Händen erhoben und auf einen anderen eingeschlagen habe. Dabei hob der Zeuge selbst demonstrativ die Hände über den Kopf und bewegte diese mit einer fiktiven Stange von oben nach unten. In der Presse habe er gelesen, so meinte er, dass es sich um ein zweieinhalb Zoll dickes Gasrohr gehandelt habe.
Die vier Männer habe er zu keinem Zeitpunkt aus den Augen verloren. Er habe gesehen, wie sie in das Fluchtfahrzeug eingestiegen seien. Erst als er schon mit der Polizei telefonierte, habe er sich das Kennzeichen des vorbeifahrenden Fahrzeuges gemerkt und dieses auch mitgeteilt.
Das Gericht und die Staatsanwaltschaft und natürlich auch wir Verteidiger hatten so unsere Zweifel. Dem Zeugen wurden seine damaligen Aussagen vorgehalten. Das sei möglicherweise falsch aufgenommen worden, meinte der Mann. Aber dann war er sich doch nicht mehr so sicher, was er denn gesehen hatte. Das Gericht meinte sinngemäß, wenn er die Auseinandersetzung tatsächlich gesehen hätte, dann wäre es doch naheliegend gewesen, das schon damals der Polizei zu berichten. Der Staatsanwalt fragte, ob es nicht beispielsweise so sein könne, dass die vier Männer in die Straße gelaufen seien und kurz darauf ein Fahrzeug von dort gekommen sei, in dem vier andere Männer gesessen hätten. Eigentlich sei das unmöglich, meinte der Zeuge, aber so ganz sicher war er sich dann doch nicht mehr, nachdem er erneut darauf hingewiesen worden war, dass er nur das sagen dürfe, was er ganz sicher erinnere.
Den Fahrer des Fahrzeuges erkenne er im Gerichtssaal wieder, meinte der Zeuge, aber das sage er besser nicht. Befragt, wen er denn meine, zeigte er auf einen der Angeklagten. Und dann: „Ich vermute vom Typ her, dass das der Fahrer war. Von der Figur her kommt das hin. Wiedererkennen will ich das nicht nennen.“ Im Rahmen von Wahllichtbildvorlagen hatte der Zeuge bei der Polizei zuvor einige der Angeklagten mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 60 oder mehr Prozent wiedererkannt. Man könnte auch sagen: Er hat sie nicht wiedererkannt.
Der Mann war – was ich im Rahmen einer Erklärung nach § 257 StPO in der Verhandlung erklärt habe – ein typisches Beispiel dafür, wie Zeugen Selbsterlebtes, Gelesenes und Kolportiertes im Nachhinein vermischen und nicht mehr wirklich voneinander trennen können. Ich denke, da waren sich die Berufsbeteiligten letztlich auch einig. Der Zeuge war – abgesehen von dem seinerzeit mitgeteilten Autokennzeichen – insgesamt nur wenig brauchbar für die Wahrheitsfindung.
Es gibt aber Fälle, da ist es weniger offensichtlich, dass Zeugen fabulieren und sich Dinge zusammenreimen, die so nicht stattgefunden haben. Es ist tragisch, wenn darauf dann falsche Urteile gestützt werden.
Kategorie: Strafblog
Permalink: Der Zeuge an sich ist unkalkulierbar
Schlagworte:
vor:
 „Die Revision wird aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen...
„Die Revision wird aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen... zurück:
 Welch ein Krimi! Nach dem Finale mit Befangenheitsgedanken von Hamburg zum...
Welch ein Krimi! Nach dem Finale mit Befangenheitsgedanken von Hamburg zum...