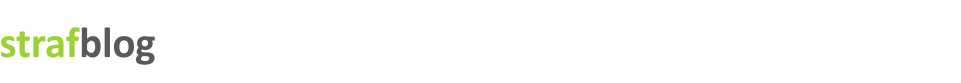Ich schnorchele durch das klare, türkise Wasser und will gar nicht mehr auftauchen. Zwar scheint es nicht mehr viele Fische im Mittelmeer zu geben, aber ich folge den wenigen vor mir mit langsamen Zügen, und weil sie entweder fair oder neugierig sind, lassen sie mich nahe heran, geben die Richtung vor und schwimmen vorsichtig zu mir zurück, ehe sie mich ganz abgehängt haben. Und da schäme ich mich für den kurzen Gedanken an die Harpune, die ich im Tauchergeschäft kurz in der Hand hatte. Die Fische schauen mich aus nächster Nähe aus ihren dunklen Pupillen an, und wer weiß, vielleicht spielen sie gerade mit dem Gedanken, mich zu beißen – nur so, um mal zu probieren, wie das sonnengerötete Fleisch dieses merkwürdigen Riesenfisches schmeckt. In Gedanken an Schätzings „Schwarm“ artikuliere ich nuschelnd aber laut das Wort „Harpune“ durch meinen Schnorchel, und die dabei entstehenden Luftblasen verschrecken die Fische für einen Moment. Ich folge ihnen weiter, höre meinen regelmäßigen Atem unter Wasser und denke. Ich denke an …, nein bitte nicht …, mein Büro. Das Wort „Urlaub“ entweicht gluckernd durch die Schnorchelröhre nach oben an die Wasseroberfläche, aber meine Gedanken sind offenbar weniger schreckhaft als die Fische. Die lassen sich nicht verscheuchen. Und so schwimme ich weiter, vorbei an den riesigen Yachten, die in der Cala vor Anker liegen, hinaus ins tiefer und dunkler werdende Meer. Mit den Menschen ist es wie mit den Fischen, denke ich. Es gibt die verschiedensten Sorten, und ich gehöre eindeutig zu den Improvisateuren, den Nichtplanern oder Chaoten, wie manch einer mich schon bezeichnet hat. Vielleicht liegt es an meinen vom Vater eingepflanzten Kölner Genen. Ich stelle mir vor, dass eines Tages mein Foto die Titelseite der Wissenschaftszeitung „Spektrum“ ziert – wie ich so am Strand in Badehose und mit hochgezogener Taucherbrille verunsichert in die Kamera lächele. Hinter mir das blaue Meer, in der Hand mein roter Schnorchel und darunter in fetten Buchstaben: „Wissenschaftliche Sensation! Erstmals gelang es Biologen, bei einem menschlichen Exemplar aus der Doppelhelix eindeutige Sätze in Kölner Mundart zu entschlüsseln.“ Und im Artikel würde dann hochtrabend mit schwindelerregenden wissenschaftlichen Begriffen beschrieben, wie die Forscher meine DNA entfaltet hatten und unter einem riesigen Elektronenrastermikroskop zunächst noch verschwommen und dann aber – nach Feinjustierung des Gerätes – eindeutig die Sätze „Et hät noch immer jot jejange!“ und „Et kütt, wie et kütt!“ sichtbar geworden waren. Also kein Wunder, dass wir „Que sera, sera!“ als diesjähriges Urlaubsmotto gewählt hatten, obwohl das zugegebenermaßen spanisch und überhaupt wie die Idee von Kölner Genen der reinste Schwachsinn ist. Während ich weiter schwimme, höre ich aus der Ferne Motorengeräusche von Booten und hoffe, dass die Freizeitkapitäne die Spitze meines roten Schnorchels knapp über der Wasseroberfläche sehen und es mir nicht geht wie einst Götz George, der beim Schwimmen vor Sardinien von einem Boot überfahren wurde und schwere Verletzungen erlitt, als er im letzten Moment noch wegzutauchen versuchte und die Schiffsschraube seinen Fuß blutig im Wasser metzelte. So jedenfalls hatte ich das mal vor Jahren in irgendeinem Wartezimmer in der „Bunten“ (?) gelesen (vgl. spiegel-online zum Prozess um das Unfallgeschehen).
Jetzt wird es mir doch zu mulmig, und ohne aufzutauchen orientiere ich mich an den Lichtverhältnissen und schwimme mit nun kräftigeren Zügen zurück zum Strand. Die Fische folgen mir in freundschaftlichem Abstand. Ich bin mal wieder zu der Überzeugung gelangt, mein Leben müsse besser organisiert werden. Sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich mit der Planung beginnen. Ich werde die Kölner Gene an die Fische verfüttern. Ich werde weit hinausfahren ins tiefe Meer der Möglichkeiten und meine Persönlichkeit über Bord werfen. Und während ich optimistisch weiterschwimme, wird das Wasser zunehmend sonnenmilchiger, die ersten Kinderbeine strampeln plötzlich dicht vor dem Glas der Taucherbrille. Die Fische sind längst zurückgekehrt ins klarere Wasser. Statt meines beruhigenden, regelmäßigen Atems höre ich einzelne Schreie der im Wasser spielenden Kinder, das lauter werdende Stimmengewirr, das vom Strand gegen die seichten Wellen heranweht. Ich tauche auf und wate durch das warme Wasser. Zusammen mit den Wassertropfen perlen die guten Vorsätze von meinem Körper ab zurück ins Meer. Anna steht mit den Füßen am Wasserrand und schaut mir erleichtert entgegen. Sie drückt mir eine kalte Dose Bier in die Hand und sagt tadelnd: „Musst du immer so weit rausschwimmen?!“
Rechtsanwalt Gerd Meister, Mönchengladbach
Kategorie: Strafblog
Permalink: Das Meer der Möglichkeiten
Schlagworte:
vor:
 Ist unsere Kanzlei jetzt ein seliger Ort? Wir hatten den Bischofsstab des...
Ist unsere Kanzlei jetzt ein seliger Ort? Wir hatten den Bischofsstab des... zurück:
 „Wenn mein Sohn redet, haben deutsche Frauen den Mund zu...
„Wenn mein Sohn redet, haben deutsche Frauen den Mund zu...