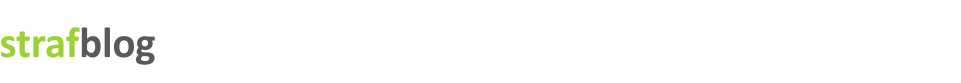Am Rande des Piratenprozesses habe ich viele Gespräche mit Prozessbeobachtern führen können. Einer davon ist Jan Kahmann, der als ehemaliger Seeleute-Gewerkschafter an fast allen Verhandlungstagen teilgenommen und mir immer wieder mal seine Meinung zu dem Verfahren mitgeteilt hat. Jan Kahmann hat seine Beobachtungen zusammengefasst und mir als Gastkommentar für den strafblog zur Verfügung gestellt. Auch wenn ich nicht alle seine Ansichten teile, erscheint es mir doch wichtig, das Verfahren einmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet zu sehen.
Der Hamburger Piratenprozess
Beobachtungen von Jan Kahmann
Am 19.10.2012, fast dreiundzwanzig Monate nach Prozesseröffnung, sprach das Hamburger Landgericht Recht über zehn somalische Piraten. „Im Namen des Volkes“ wurden sieben Piraten zwischen sechs und sieben Jahren, und drei nach dem Jugendstrafrecht zu zwei Jahren Haft verurteilt.
Es war der Dauer des Verfahrens zu verdanken, dass das Gericht aus dem Kreis der Piraten etwas davon erfuhr, wie sich die Kaperung des deutschen Containerschiffes „Taipan“ am 05.04.2010 im Indischen Ozean abgespielt haben könnte. Einem der Angeklagten platzte am achtundsiebzigsten Verhandlungstag der Kragen. Nach fast eineinhalb Jahren Lügengeschichten in diesem Verfahren wolle er nun aussagen. Sicher hat er nicht nur Wahres gesagt, besonders, wenn es um seine Verstrickung in die Tat ging, die er vermutlich sehr beschönigte.
Ruhig und besonnen führte der vorsitzende Richter durch das Verfahren. Man spürte, dass es ihm wichtig war, den Beschuldigten respektvoll gegenüberzutreten und nicht den Eindruck zu vermitteln, der Prozess werde abgewickelt. Meines Erachtens war das Verfahren ein Beispiel dafür, dass sich Solidität eines Rechtsstaates auch darin zeigt, wie er mit Beschuldigten umgeht, die aus einem Land kommen, das keine Rechtsstaatlichkeit, keine Gesetze kennt, es sei denn, das des Stärkeren.
Die Sorgfalt des Verfahrens kollidierte mit einer öffentlichen Diskussion um Dauer und Kosten des Prozesses. Das Gericht ist dafür nur wenig verantwortlich zu machen. Einige Verfahrensschritte brauchten Zeit, z. B. die Begutachtung des Alters von drei Angeklagten oder die Gutachter, die Somalia dem Gericht und den Anwälten näher brachten.
Der Prozess schleppte sich zeitweilig auch mühsam hin, weil die Ermittlungen nach dem Überfall auf die „Taipan“ nicht sehr überzeugend geführt wurden. Es gab keine Ermittlungen auf der Dhau „Hud Hud“. Immerhin war diese gekaperte Dhau das Mutterschiff der Piraten und damit Teil des Tatortes. Auf der „Hud Hud“ befanden sich zwölf indische Seeleute in der Hand der Piraten. Sie hätten sicher viel zur Tat und zur Hierarchie der somalischen Piraten aussagen können, wenn man sie rechtzeitig befragt hätte. Gelegenheit dazu gab es, zwei Monate nach dem Überfall lag die „Hud Hud“ vierzehn Tage in Dubai. Das BKA habe davon erst nachträglich erfahren, sagte ein BKA-Beamter vor Gericht aus.
Aufgehalten hat den Prozess auch ein anwaltliches Antragsunwesen. Sechs Befangenheitsanträge, vier alleine von einem Anwalt, legten zeitweilig die Hauptverhandlung lahm, kosteten Zeit und Aufwand. Befangenheitsanträge scheinen ein beliebtes juristisches Spielzeug zu sein, mit dem man das Gericht ärgern und beschäftigen kann. Dieses Schutzrecht wird jedoch entwertet, wenn die Begründungen immer dürftiger werden, so z. B., weil der Richter in einem offiziellen Schreiben eine Terminänderung, über den Kreis der Prozessbeteiligten hinaus, auch einem Vertreter der Wasserschutzpolizei mitgeteilt hatte, die ein besonderes Interesse an der Verurteilung des Angeklagten habe.
Als Beobachter wunderte ich mich gelegentlich über die ausführliche Beschäftigung mit erstaunlichen Anträgen. Manchmal schimmerte mehr der nicht ganz selbstlose öffentliche Effekt als das Verteidigungsziel durch. Da sollten Bundesminister, höchste Beamte und Militärs als Zeugen geladen und ein indischer Botschafter zur Postzustellung von Seeleuten in Indien befragt werden.
Ein Antrag lud den Anführer des Überfalls auf die „Taipan“, der unbehelligt in Somalia lebt, in die Höhle des Löwen, zum Landgericht nach Hamburg, ein. Er sollte als Zeuge aussagen.
Das Gericht hingegen sollte nach Mogadischu reisen und, geschützt von teuren somalischen Bodyguards, dort einen Zeugen vernehmen, von dem man auch vermuten konnte, dass er der Piraterie nicht ganz fernstand. Er sollte einen Piraten entlasten. Eine Begründung der Reise nach Somalia, wo Piraterie über ein gewisses Ansehen, Geld und Macht verfügt, lautete: Ein Gericht, das Angst hat, ist hier fehl am Platze. Zur Sicherheit der Kammer in diesem von Gewalt beherrschten Land sollten die örtlichen Clanführer über die Ankunft eines deutschen Gerichtes informieren werden, und, wenn erforderlich, auch landesüblicher Bakschisch fließen.
Der Prozess war ein Täterprozess, die Opfer kamen kaum vor. Zwei davon, Seeleute der „Taipan“, traten vor Gericht auf, wurden aber weniger als Opfer denn als Zeugen der Kaperung wahrgenommen. Erst in der Urteilsbegründung nannte der Richter die Namen aller auf der Taipan gekidnappten Seeleute.
Ein Grund für diese mangelnde Opferempathie war, dass Geschädigte in dem Prozess eigentlich nicht auftraten. Es gab keine Nebenkläger und kein Anwalt nahm die Rechte eines betroffenen Seemannes oder die Interessen anderer Geschädigter wahr. Dieser Antrieb zur Aufklärung fehlte dem Prozess.
Mit welcher Klage hätte ein Seemann auch auftreten sollen? Freiheitsberaubung, weil die Crew einige Stunden in der Zitadelle ausharren musste, oder wegen einiger gestohlener Handys oder Geldbörsen, die sie später zurückerhielten? Für die Seeleute war der Fall mit der Befreiung durch die niederländischen Soldaten beendet. Kapitän des Containerschiffes brachte das gut zum Ausdruck, als er die Entschuldigung eines Piraten annahm.
So blieben dann Argumente aus den Plädoyers unwidersprochen, z. B. die Piraten hätten sich ja nicht der Seeleute bemächtigt, denn die seien ja in der Zitadelle und zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Die Somalier hätten sie ja gesucht. Nur! Möchte man hinzufügen. Das hörte sich so an, als hätte die Crew der „Taipan“ sich auch in einer Schiffskammer aufhalten können, gefahrlos und jederzeit in der Lage, an die frische Luft zu gehen. Hätte sie das getan, wären die Piraten erfolgreich gewesen. Hier kollidierte eine juristische Argumentation mit menschlicher Vernunft oder einfacher ausgedrückt: Die Vernunft der Seeleute, in der Zitadelle Schutz zu suchen, hat nach Auffassung einiger Verteidiger aus dem Menschenraub einen versuchten Menschenraub gemacht.
Überhaupt, über Opfer oder Opferbetroffenheit wurde in dem Prozess wenig gesprochen. Einige Verteidiger bemühten sich, für mich etwas zu verkrampft, auf die Lage der Seeleute der „Taipan“ einzugehen. Es fiel auch nicht schwer, die Opfer zu übergehen, es gab weder Verletzte noch andere ernsthafte Schäden zu beklagen, höchstens bei einigen ein kleiner psychischer Knacks, Angst oder die Erinnerung an das Eingesperrtsein in der Zitadelle.
Wie der Prozess wohl verlaufen wäre, wenn hier die Piraten der „Beluga Nomination“ oder der „Hansa Stavanger“ vor Gericht gestanden hätten? Zugegeben, das waren andere Piraten und vor Gericht stand nicht die Piraterie, sondern zehn Piraten. Aber der Vergleich drängte sich in dem Verfahren manchmal auf.
Mangelnde Empathie zeigte sich besonders auch gegenüber den indischen Seeleuten der Dhau „Hud Hud“. Mir bleibt es unverständlich, warum die Entführung der Dhau „Hud Hud“ nicht von Amts wegen verfolgt wurde. Fünfundsechzig Tage waren die zwölf indischen Seeleute in Geiselhaft, ihre Entführer sitzen in Hamburg vor Gericht und „keinen kümmert“ es. Es bleibt der Eindruck, dass das Unrecht, dass den indischen Seeleuten angetan wurde, wenig bedeutend war. Die Inder hatten einfach keine Fürsprecher im Gerichtssaal. Aber sie sollten Zeugen für die Verteidigung sein und es wehte ein Hauch von Kolonialismus durch den Gerichtssaal, als die Anträge für ihre Vernehmung immer schärfer wurden, obwohl bekannt war, dass sie das nicht wollten.
Was sollten sie auch aussagen? Sie sind Seeleute, und wenn sie wieder auf einer Dhau fahren, um damit ihre Familien dürftig zu ernähren, und somalische Häfen wie Mogadischu oder Boosaaso anlaufen, wollen sie auch wieder heil auslaufen. Hinter der Piraterie, das zeigte der Prozess, stehen große und finanzkräftige Strukturen, die weit über Somalia hinausreichen.Wer schützt diese Zeugen? Wenn einer von ihnen wegen einer Aussage gegen die Piraten in Somalia verschwindet, nimmt das in Deutschland keiner wahr. Wie viel Risiko darf eine Verteidigung aus einem geschützten rechtsstaatlichen Raum einem nicht aussagewilligen Zeugen zumuten, der diesen Schutzraum nicht genießt?
Unappetitlich war der Umgang mit einem deutsch-indischen Journalisten. Der hatte zwei Seeleute der Dhau „Hud Hud“ in Indien aufgesucht und brachte für die Verteidigung unbequeme Interviews mit. Die Gegenstrategie war, den Journalisten unglaubwürdig zu machen, und mit ihm sein Aussagematerial und die beiden Seeleute. Er wurde nach Quellen befragt. Der Journalist berief sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht. Dass er im Zeugenstand die Gründe für sein Zeugnisverweigerungsrecht nicht beeiden musste, ist dem vorsitzenden Richter zu verdanken. Er erkannte, dass es schlecht zusammenpasst, wenn Anwälte sich auf ein Schweigerecht berufen, ein ähnliches Recht von Journalisten aber erst nach einem Eid akzeptieren. Beachtlich: Ein Verteidiger stellte sich auf die Seite des Journalisten.
Die meisten Verteidigungen sahen Not und Elend in Somalia und das schwierige und auswegslose Leben ihrer Mandanten als Ursache für die Beteiligung an der Piraterie. Einige trugen vor, sie seien zur Tat gezwungen worden. Einige Verteidigungen setzten zusätzlich starke politische Akzente. Die Beschuldigten seien Opfer eines vom Westen verlassenen, missbrauchten und ausgebeuteten Landes. Es handele sich um einen politischen Prozess, wo ein westlicher Staat den gebeutelten und unterdrückten Menschen einer unterentwickelten Region, die nur ihr Recht auf Leben in Anspruch nähme, seine Macht und Stärke zeige. Somalia sei ein „Failed State“, das Verfahren sei ungerecht. Vor dieser Apokalypse passierten Schiffe mit den Reichtümern der westlichen Welt.
Es schimmerte gelegentlich Verständnis durch, dass es erlaubt sein müsse, sich vor solchen einem Hintergrund selbst zu bedienen und Schiffe zu kapern. Nicht zur Sprache kam dabei, dass für dieses Ziel zunächst Seeleute geraubt werden von denen die meisten selbst aus Ländern der Dritten Welt kommen, die mit ihren oft unter miesen Bedingungen verdienten Heuern ihre Familien ernähren. Bei mancher Argumentation hatte ich das Gefühl, dies sei halt ein unvermeidlicher Kollateralschaden.
Das Verfahren ist meines Erachtens nicht ausreichend der Frage nachgegangen, ob das Schiff „Taipan“ für eine Reise durch von Piraten gefährdetes Gebiet ausreichend ausgerüstet war. Im Gericht wurden Luftaufnahmen von dem Überfall gezeigt. Die lassen Zweifel an der notwendigen Ausrüstung des Schiffes aufkommen. Zu sehen sind Decksschläuche, deren Strahl nach außenbords mehr einer Dusche ähnelt, als Verteidigungszwecken. Entlang der Reling erkennt man eine Reihe Natodraht. Das bot vielleicht etwas Schutz, aber für ein Schiff wie die „Taipan“, mit mäßiger Höchstgeschwindigkeit und geringem Freibord war das zu wenig, trotz Zitadelle. Im Gerichtssaal fehlte dazu die kritische Nachfrage. Das Seemannsgesetz schreibt dem Reeder vor, den Schiffsbetrieb so einzurichten, dass die Besatzung gegen Gefahren für das Leben auf See ausreichend geschützt ist. Die Piraten hatten aber keine Schwierigkeiten, das Schiff zu entern und dann direkt zur Brücke zu gehen. Das Seemannsgesetz war in dem Verfahren kein Thema. Offensichtlich bietet dieses Gesetz bei Fahrten durch Piraterie gefährdete Seegebiete den Seeleuten keinen Schutz.
Eine rechtliche Schwierigkeit bestand darin, dass Militärs, in diesem Fall niederländische, polizeiähnliche Aufgaben wahrgenommen hatten und sich daran ein ziviles Strafverfahren anknüpfte. Tatermittlung, „Vernehmung“ oder Befragung, „Festnahme“ oder Festhalten sind Stichworte dazu. Militärs folgen dabei mehr ihren internen strengeren Üblichkeiten als denen der zivilen Strafprozessordnung. Strategie und Geheimnisse spielen bei ihnen eine große Rolle und sie entscheiden, welche Erkenntnisse der zivilen Tatermittlung und Strafverfolgung zur Verfügung gestellt werden. Das muss sich nicht unbedingt nach dem öffentlichen Interesse und Rechtsverständnis richten. Was andere nicht erfahren sollen, erhält schnell den Stempel „Militärisches Geheimnis“, Behinderung von Aufklärung eingeschlossen. In dem Prozess blieben so einige Aufklärungswege unerschlossen, vermutlich auch der zu Hintermännern.
Ein Verteidiger führte in seinem Plädoyer aus, entgegen seiner früheren Auffassung gehöre dieser Prozess nicht nach Deutschland, nicht nach Hamburg. Das Tatgeschehen habe sich für eine Aufklärung räumlich zu weit entfernt abgespielt, und der Prozess sei auf zu viele Schwierigkeiten gestoßen, die etwas mit Entfernung und Fremde zu tun hätten. Das reiche von der Zeugenladung bis zu den Haftbedingungen, weil die somalischen Untersuchungshäftlinge in Deutschland keinen Besuch von ihren Familienangehörigen empfangen konnten. Einen Rat, wo und wie solche Prozesse stattfinden sollten, könne er aber auch nicht geben.
Ja, der Prozess stieß bei der Vernehmung ausländischer Zeugen an Grenzen, besonders jener aus Somalia. Es war aber auch kaum nachzuvollziehen, dass in einem „Failed State“, der weder Recht noch öffentliche Ordnung, sondern nur Gewalt kennt, ein Zeuge frei in seiner Aussage sein soll und wie mit einer auch möglichen Falschaussage umgegangen wird. In schwierigen Verfahrensfragen das Recht zu pflegen und es nicht grundsätzlich infrage zu stellen oder gar die Einstellung und Freilassung der Beschuldigten zu fordern, wäre auch Aufgabe der Verteidigung gewesen. Da konnte man, salopp gesagt, wenig rechtliche Innovation erkennen. Die Angriffe auf die Zuständigkeit des Gerichts richteten sich gegen die Opfer. In Konsequenz bedeutete dies, dass Geiseln, vielleicht sogar ihre Hinterbliebenen, gekaperter deutscher Frachter ihr Recht demnächst in einem fernen Staat mit vielleicht zweifelhaftem Rechtssystem durchsetzen müssten. Die Billige Flagge lässt grüßen. In der Luftfahrt hätte so ein Gedanke sicher kaum den Weg ins Gericht gefunden.
Es ist zu befürchten, dass die Piraterie zunimmt, vielleicht nicht in Somalia. Seeleute haben ein Recht auf Unversehrtheit bei der Ausübung ihres Berufes und der Piraterie muss ein Strafrecht gegenüberstehen, auf das Seeleute und auch andere Beteiligte sich verlassen können. Solange es keine internationalen Regelungen gibt, die Piraterie zu ahnden, bleibt nur der Flaggenstaat. Den Flaggenstaat hier infrage zu stellen, leistet auch der Selbstverteidigung Vorschub. Dann werden die Fälle auf See entschieden, von bewaffneten Wachleuten, und kein Rechtssystem stört.
In seiner Urteilsbegründung hat der vorsitzende Richter dazu ausgeführt, dass es gerade für Seeleute, die ja häufig auch arm sind, wichtig ist, dass es ein Gericht gibt, das sich mit ihren Rechten beschäftigt. Dem kann man sich nur anschließen.
Vielleicht könnte eine Kammer am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg diese Lücke schließen. Aber, so erläuterte der Richter in seiner Begründung, der Internationale Gerichtshof hat bei Piraterie keine völkerrechtliche Kompetenz. Vielleicht gibt der Prozess Anlass darüber nachzudenken.
Jan Kahmann
Bremen, 23.10.2012
Anmerkung RA Pohlen: Dass die Kaperung der Hud Hud nicht von Amts wegen verfolgt wurde, liegt jedenfalls auch daran, dass dieser Vorfall nicht angeklagt war und wegen des im Auslieferungsrecht geltenden Spezialitätsgrundsatzes auch nicht verfolgt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft hatte noch kurz vor der Haftentlassung der 3 jungen Angeklagten versucht, die Kaperung der Hud Hud ins Spiel zu bringen, um die Aufhebung der Haftbefehle zu verhindern. Damit ist sie bei der Kammer gescheitert.
Kategorie: Strafblog
Permalink: Die andere Meinung: Gastkommentar von Jan Kahmann zum Hamburger Piratenprozess
Schlagworte:
vor:
 „Geben Sie Ihr Heroin bitte hier an der Pforte ab, Herr...
„Geben Sie Ihr Heroin bitte hier an der Pforte ab, Herr... zurück:
 Nachlese zum Piratenprozess: Ist das Verfahren gescheitert? Das Leben...
Nachlese zum Piratenprozess: Ist das Verfahren gescheitert? Das Leben...