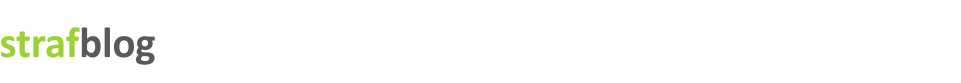Gestern war ich zum ersten Mal in meinem 3 Jahrzehnte währenden Anwaltsleben beim Amtsgericht in Warendorf. Ich glaube nicht, dass ich außerhalb meines Berufsleben schon einmal in der im Münsterland liegenden 20.000-Seelen-Gemeinde gewesen bin, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran.
Das Amtsgericht liegt in einer verkehrsberuhigten Zone gegenüber dem Friedhof. Auf dem Weg dorthin schlängelt man sich mit einer Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h durch nette Anliegersträßchen mit Einfamilienhäusern, die durch willkürliche Fahrbahnverengungen ein schnelleres Fahren kaum ermöglichen. In so einer Wohngegend mag man alles Mögliche erwarten, aber sicher kein Gericht. Das Gerichtsgebäude sieht ein wenig aus wie ein zweigeschossiger Schuhkarton, der aktuell wegen umfangreicher Fassadenrenovierung eingerüstet und teilweise mit Planen verdeckt ist, wodurch die Zweckbestimmung des Baus noch weniger zu erkennen ist. Leider habe ich im Anschluss an die Terminswahrnehmung vergessen, ein Foto zu machen, welches ich den strafblog-Lesern präsentieren könnte. Ich war wohl zu sehr ins Gespräch mit meinem Mandaten vertieft, um daran zu denken.
Irgendwie passte das Gerichtsgebäude zu dem skurrilen Fall, mit dem ich zu tun hatte. Diesmal ausnahmsweise nicht auf Verteidigerseite, sondern als Vertreter des Geschädigten. Ich mache das nur ganz selten, eigentlich will ich nämlich gar nicht auf der anderen Seite stehen (oder sitzen). Dafür bin ich viel zu sehr meinem Verteidigerdenken verhaftet. Ich möchte nur ungern vormittags als Verteidiger in die eine Richtung plädieren und nachmittags als Nebenklagevertreter oder Zeugenbeistand auf der Seite des Geschädigten in die andere.
Ein Bekannter hatte mich vor geraumer Zeit darum gebeten, einem auf den Bahamas lebenden Freund zu helfen, von diesem verliehenes bzw. vorfinanziertes Geld von einem in Deutschland lebenden anderen Freund zurückzuholen. Wobei „Freund“ in diesem Fall wohl in Anführungszeichen zu setzen ist. Dieser Mensch, nennen wir ihn Paul, hatte meinem Mandaten einst erzählt, er besitze ein paar Millionen Anteile (sog. Shares) an einer US-Technologie-Firma, die er verkaufen wolle. Er erwarte aus dem Geschäft etliche Millionen Dollar Gewinn. Allerdings gebe es da noch gewisse rechtliche Probleme, die er nur mit Hilfe von US-amerikanischen Anwälten klären könne. Hierfür benötige er Geld, das er derzeit nicht habe.
Mein Mandant hat Paul im Laufe der Zeit ein paar zehntausend Dollar zugewendet, damit der sein Recht durchsetzen könne. Paul sei ein richtig guter Freund der Familie gewesen, fast wie ein Sohn, erzählte mir mein Mandant. Natürlich habe er ihm voll vertraut. Erst als er sein Geld zurück haben wollte und vielleicht auch einen Teil der ihm versprochenen Gewinnbeteiligung, stellte sich heraus, dass Paul keineswegs Anteilseigner der betreffenden Firma war. Die behaupteten Geschäfte erwiesen sich als Luftnummer, vorgelegte Unterlagen waren gefaked, Unterschriften gefälscht worden.
Mein Mandant ist ein gutmütiger Mensch. Trotz aller menschlichen Enttäuschung wollte er Paul nichts Böses. Aber sein Geld wollte er zumindest zurückholen, dabei sollte ich ihm behilflich sein.
Ich habe Paul telefonisch kontaktiert. Ich habe ihm gesagt, wer mich beauftragt hat und dass wir eine einvernehmliche Lösung wollten, ohne Polizei und Staatsanwaltschaft. Paul teilte mir mit, Alles sei ganz anders, als es scheine. Nein, er sei kein Betrüger, das werde er schon beweisen. Da seien nur ein paar Dinge unglücklich gelaufen, aber das große Geld komme noch. Derzeit sei er krank, sehr krank sogar, aber sobald es ihm besser gehe, werde er auf die Bahamas fliegen, um die Angelegenheit mit meinem Mandanten persönlich zu klären. Er hätte sogar schon ein Ticket nach Nassau gebucht gehabt, den Flug aber leider gesundheitsbedingt stornieren müssen.
Ich habe Paul eine Woche später in Münster am Bahnhof getroffen. Er sah ziemlich krank aus und machte einen geschwächten Eindruck. Er erzählte mir etwas von einer mysteriösen Krebserkrankung und von ärztlichen Verboten, das Krankenhaus zu verlassen. Aktuell habe er sich heimlich davon geschlichen, das dürften die Ärzte gar nicht erfahren. Paul erzählte von anstehenden großen Geschäften, die er machen werde, darin seien die US-Armee und der Geheimdienst involviert. Er hätte bedeutende Erfindungen gemacht mit hoher militärischer Relevanz, darüber dürfe er – das verstehe sich ja von selbst – natürlich keine Einzelheiten berichten. Top secret eben, ist doch klar. Ich habe versucht, die Sache auf den Kern zurückzuführen. Wann mein Mandant sein Geld bekomme, habe ich wissen wollen.
Spätestens in zwei Wochen, lautete die Antwort, dann werde er erst einmal zweihundertfünfzigtausend Dollar an ihn zahlen, möglicherweise auch mehr. Paul ließ sich die Nummer unseres Anderkontos geben, auf dem wir bisweilen treuhänderisch Mandantengelder verwahren. Er werde dafür Sorge tragen, dass die Viertelmillion dorthin transferriert werde, meinte er, das gehe jetzt ratzfatz. Ich habe gewisse Zweifel angemeldet, aber die ließ Paul nicht gelten. „Sie werden schon sehen“, meinte er.
Was nicht kam, war das Geld. Aber Paul rief immerhin an und bat darum, sich noch zu gedulden. Krankheitsbedingt („Sie wissen schon“) habe er sich mit den Geldgebern noch nicht treffen können. Auch müsse er noch Details mit meinem Mandanten klären, deshalb fliege er ja auf die Bahamas. Sobald es geht. Ehrenwort. Die Tickets habe er ja schon, die müssten nur noch umgebucht werden. Als ich die Tickets sehen wollte, reagierte Paul beleidigt. Ob ich ihm nicht glaube, fragte er mich. „Wo du deinen Glauben gelassen hast, da sollst du ihn suchen“, habe ich geantwortet. Glauben könne man in der Kirche oder im Gebet, als Anwalt brauche ich Fakten. Die Tickets hat er mir trotzdem nicht gezeigt.
Ich habe meinen Mandanten per email unterrichtet. In englischer Sprache. Ob ich Paul glaube, hat er mich gefragt. „Nicht die Bohne“, habe ich geantwortet, sinngemäß natürlich nur, „Not the Bean“ hätte er wohl kaum verstanden. Ich solle ihm eine letzte Frist setzen und ihm für den Fall fruchtlosen Fristablaufs („fruitless deadline expiration“ :)) eine Strafanzeige androhen, hat mein Mandant vorgeschlagen. Das habe ich dann auch gemacht. Paul rief mich an und meinte, das habe er nicht verdient. Er sei gerade auf dem Weg nach Frankfurt, wo er sich im US-Konsulat mit hochrangigen Persönlichkeiten treffen werde. Da würden hochgeheime Projekte besprochen und ihm sei auch eine beachtliche Zahlung zugesagt worden. Ich würde schon sehen, nächste Woche sei das Geld für meinen Mandanten auf dem Anderkonto. Das hatten wir doch schon einmal, dachte ich. Und habe es auch laut gesagt. Paul reagierte beleidigt und legte auf.
Dann rief er von Frankfurt aus an. Das behauptete er wenigstens. Die Verhandlungen dort verliefen erfolgversprechend. Es müssten noch ein paar Dokumente erstellt werden, dann komme das Geld. Er habe seinen eigenen Anwalt aus dem Münsterland anreisen lassen, der entwerfe gerade die Dokumente. Wie der Anwalt heiße, habe ich gefragt. Das gehe mich gar nichts an, meinte Paul. Wichtig sei doch nur, dass das Geld komme. Paul meinte, er würde auf dem Rückweg von Frankfurt bei mir in Mönchengladbach vorbeikommen und mir Kopien der Verträge zeigen. Leider dürfe er sie nicht aus der Hand geben, auch nicht in Kopie. Alles top secret, wir erinnern uns.
Leider wurde Pauls Frau unerwartet krank. Also konnte er nicht bei mir vorbeikommen, er musste dringend nachhause. Ich habe Paul gesagt, dass ich mich veräppelt fühle. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihm kein Wort glaube und auftragsgemäß Strafanzeige erstatten würde. Sie können ja meinen Anwalt anrufen, wenn Sie mir nicht glauben, meinte Paul und teilte mir dessen Namen und Kanzleisitz mit. Erstaunlicherweise gab es den Kollegen tatsächlich. Der bestätigte mir auf telefonische Anfrage hin, dass er Paul kenne. Nein, aktuell vertrete er ihn nicht. Er sei auch nicht für ihn in Frankfurt gewesen. Zwischen den Zeilen meinte ich zu erkennen, dass der Kollege nicht unerhebliche Honorarforderungen gegen Paul hatte und wenig hoffnungsfroh war, diese jemals realisieren zu können.
Ich habe noch ein letztes Mal mit Paul telefoniert. Der wurde ziemlich laut, als ich ihm meinen Erkenntnisstand vorhielt, regelrecht unhöflich sogar, ich solle doch machen, was ich wolle.
Ich habe schließlich im Auftrage meines Mandanten Strafanzeige wegen Betruges und Urkundenfälschung gegen Paul erstattet. Leicht gefallen ist mir das nicht, ich bin ja eigentlich Verteidiger und habe nicht ganz selten mit Kandidaten wie Paul zu tun. Zusammen mit der Strafanzeige habe ich viele Unterlagen vorgelegt, die meisten in englischer Sprache. Ich habe die wesentlichen Passagen selbst übersetzt, aus Kostengründen. Wenn das nicht ausreichend sein sollte, könnte die Staatsanwaltschaft die Unterlagen ja beglaubigt übersetzen lassen, es gibt ja so etwas wie den Amtsermiittlungsgrundsatz, habe ich mir gedacht.
Der Staatsanwalt war nicht begeistert über den Fall und hat die Akten ziemlich lange liegen gelassen. Dann wurde Paul zur polizeilichen Vernehmung geladen, erschien dort aber nicht. Schließlich wurde ein lauer Strafbefehl wegen Betruges gegen ihn erlassen, wegen etwas mehr als 6 Tausend Euro Schaden. Wo die Staatsanwaltschaft den übrigen Schaden gelassen hat, weiß ich nicht. Immerhin 250 Tagessätze Geldstrafe zu je 50 Euro hat das Amtsgericht Warendorf antragsgemäß festgesetzt, keine allzu harsche Sanktion.
Paul war darüber gleichwohl nicht sonderlich glücklich, jedenfalls hat er Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Deshalb kam es jetzt zur Verhandlung. Das heißt, eigentlich wurde gar nicht verhandelt, denn Paul ist gar nicht erst zur Verhandlung erschienen. Immerhin tauchte ein Anwaltskollege als sein Verteidiger auf, aber der konnte keine Auskunft über den Grund des Fernbleibens nennen, und hat sich vorsorglich geweigert, für seinen Mandanten aufzutreten. Dessen Einspruch gegen den Strafbefehl hat die Kammer daraufhin verworfen.
Mein Mandant, der sich gerade in Europa aufhält, war vom Gericht als Zeuge geladen worden. Von Krakau in Polen aus ist er vorgestern an seine vorübergehende Anschrift in Hagen zurückgekehrt, eigentlich nur für den Prozess. Von Hagen bis nach Warendorf sind´s rund 90 Kilometer. Von dort aus wollte er nach Krakau zurück. Das Gericht hatte vorab bereits mitgeteilt, dass Kosten nur für eine Hin- und Rückreise von und nach Hagen erstattet würden, mehr nicht.
Ich selbst bin auf Wunsch meines Mandanten von Mönchengladbach aus nach Warendorf gereist, um ihn vor Gericht zu unterstützten. Das sind hin und zurück schlappe 370 Kilometer. Fast schon absehbar war das so ziemlich für die Katz. Den Adhäsionsantrag, den ich mitgebracht hatte, konnte ich in der Tasche stecken lassen.
Jetzt wird abzuwarten bleiben, ober der kluge Paul gegen den Verwerfungsbeschluss Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen wird, weil er völlig unerwartet so krank geworden ist, dass er dem Gericht hierüber nicht einmal Bescheid geben konnte. Oder ob er gegen das den Einspruch verwerfende Urteil Berufung einlegt. Nur aus Prinzip, oder um die Kosten des Geschädigten noch ein Stück in die Höhe zu treiben.
Bis es zu einer neuen Verhandlung kommt, sind dann bestimmt auch die Fassadenarbeiten am Gerichtsgebäude beendet, so dass ich dieses in seiner vollen Schönheit bewundern kann. Allein dafür könnte die Fahrt sich ja schon lohnen…
Dann werde ich auch ein Foto vom Gerichtsgebäude machen, ganz bestimmt!
Kategorie: Strafblog
Permalink: Von Krakau zum Amtsgericht nach Warendorf – Eine ziemlich unnütze Reise
Schlagworte:
vor:
 15.000 Tage und Nächte unschuldig im Gefängnis – Hat die Polizei...
15.000 Tage und Nächte unschuldig im Gefängnis – Hat die Polizei... zurück:
 „Herr Rechtsanwalt, ich bin enttäuscht von Ihnen“ – Ein...
„Herr Rechtsanwalt, ich bin enttäuscht von Ihnen“ – Ein...